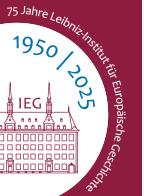Supplements online
| Susan Rößner *
|
|
Inhaltsverzeichnis |
Gliederung: Das Commonwealth oder Europa?
Ein europäisches Geschichtsbewusstsein?
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Zitierempfehlung
Text:
Begibt man sich in der Geschichte der Geschichtsschreibung auf die Suche nach Hinweisen auf ein europäisches Geschichtsbewusstsein, so scheint ein Blick in »Europa«geschichten, die in Form großer universalhistorischer Synthesen und oft mehrbändiger Monumentalwerke immer ein großes Publikum gefunden haben, vielversprechend. Wer sich mit der Geschichte Europas befasst und darüber schreibt, so könnte die logische Schlussfolgerung heißen, der hat auch einen aktiven, »bewussten« Zugang zur Vergangenheit Europas. Er beschäftigt sich, so meint man, nicht nur mit der Geschichte seines Landes, sondern lässt nationale Schranken hinter sich und denkt in europäischem Maßstab.
Dass dies für den Großteil der Historiker jedoch nicht zutrifft, zeigt bereits der Titel der Mainzer Tagung, der die Geschichtsschreibung noch auf dem Weg zu einem europäischen Geschichtsbewusstsein wähnt, nicht aber bereits am Ziel angekommen. Für die Geschichte der Geschichtsschreibung darf also davon ausgegangen werden, dass die Zeugnisse europäischen Geschichtsbewusstseins eher marginal ausfallen. Einen Grund dafür sieht der folgende Beitrag in den nationalen historiographischen Produktionsbedingungen der Europageschichtsschreibung. Gegenstand der Untersuchung sind dabei nicht die strukturellen Voraussetzungen geschichtswissenschaftlichen Arbeitens wie die Soziogenese der Historiker, ihre institutionelle Anbindung, Fragen der Forschungsförderung oder ihre teilweise enge Verknüpfung mit dem Staat. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die theoretischen und methodologischen Ansätze, auf deren Grundlage Geschichtsschreibung – und damit auch Europageschichtsschreibung – betrieben wurde, und die Verbindungen, die sich zwischen historiographischen Vorannahmen, dem Europabild der Historiker und ihrem europäischen Geschichtsbewusstsein ausmachen lassen. Die Wirkkraft theoretischer Rahmenbedingungen ist nicht zu unterschätzen: anders als ad hoc greifende Anlässe und historische Zäsuren wie die Weltkriege, die die Produktion von Europageschichten beeinflussen oder erst veranlassen, stellt die historiographische Tradition einen Faktor dar, der häufig über mehrere Historikergenerationen hinweg wirkt. Diese Traditionen sind national bestimmt und prägen auch heute noch jeden Historiker grundlegend, der das universitäre System seines Landes durchläuft. Für das Verfassen von Europageschichten hingegen wurde man nicht ausgebildet. Manch einer fühlte sich hierzu berufen, wie etwa der englische Autor Herbert George Wells, der sich für »if not specially equipped, at least specially disposed« hielt.[1] Bei anderen mag die Motivation zum Verfassen einer Europageschichte hauptsächlich in den lukrativen Verdienstmöglichkeiten bestanden haben.[2] Die Bewohner einer in Auflösung befindlichen Welt – wie es nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war – suchten in den Synthesen Orientierung, Informationen und nicht zuletzt ästhetischen Lesegenuss und bescherten den Historikern auf diese Weise enorme Verkaufszahlen. Bei den Autoren der Europageschichten ist daher kaum mit einer ›idealistischen‹ Einstellung zur Europageschichtsschreibung, und weniger noch mit ihrer Prädisposition qua Ausbildung zu rechnen. Will man also in der Geschichte der Geschichtsschreibung Spuren eines europäischen historischen Bewusstseins finden, kommt man nicht umhin, die Bedingungen und Motivationen, die sich aus den nationalen Traditionen der Geschichtsschreibung ergeben, zu berücksichtigen. Im Folgenden soll anhand der liberalen englischen Whig-Historiographie gezeigt werden, welchen Einfluss die Art und Weise, Geschichte zu schreiben, auf das Europabild der Historiker hatte. Analysiert werden Europageschichten englischer Historiker der 1920er Jahre.
117
Aufgrund einer – etwa im Verhältnis zu Deutschland, wo der Historismus lange Zeit die unbestrittene Leitidee war – relativ großen Vielfalt der englischen Geschichtsschreibung ist zunächst fraglich, ob hier von nur einer historiographischen Tradition gesprochen werden kann. Ähnlich dem Historismus nimmt jedoch die Whig-Historiographie, zumal in der ersten Jahrhunderthälfte, eine starke Stellung in der englischen Geschichtswissenschaft ein. Zwar sind auch hier die zentralen Themen, die der Verfassungsgeschichte, der imperialen Expansion und der Industrialisierung, stark von der politischen Entwicklung des Landes geprägt.[3] Wie der Historismus kann darüber hinaus auch die Whig-Geschichtsschreibung nicht allein als wissenschaftlicher Ansatz betrachtet werden: Sie war in gewissem Maße immer auch eine politisch-gesellschaftliche Grundeinstellung. Jedoch ist die Beeinflussung der Lebenswelt der Historiker weitaus weniger stark gewesen. Weniger als der Historismus in Deutschland hatte die Whig-Geschichtsschreibung den Charakter einer Doktrin, die die Deutung der Geschichte für sich beanspruchte.[4] Im Gegensatz zu den deutschen waren die englischen Historiker institutionell häufig nicht eingebunden, sondern schreibende Privatmänner, und schon aus diesem Grund politischer Vereinnahmung ein Stück weit entrückt.[5] Die größere Offenheit der englischen Geschichtswissenschaft zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sich parallel neue starke Ansätze formieren konnten, so zum Beispiel die konservative und marxistische Geschichtsschreibung.[6] In der Tat hatte gerade der Erste Weltkrieg dazu geführt, die Richtigkeit whigscher Grundannahmen in Frage zu stellen. Dennoch wurden die auftretenden Neuerungen nicht unwesentlich von den Leitlinien der Whig-Geschichte beeinflusst. Die dort so prominente Erzählung von der Fortdauer der britischen Institutionen beispielsweise wurde auch in der konservativen Geschichtsschreibung zu einem wichtigen Aspekt[7], und die marxistische Historiographie teilte mit der Whig-Geschichtsschreibung den Glauben an den teleologischen Charakter der Geschichte und eine beständige Fortentwicklung in Kombination mit der Umsetzung einer von vornherein angelegten Idee. Während bei den Marxisten die Vorstellung leitend war, Geschichte habe ihren Kernpunkt in den ökonomischen Verhältnissen und der Kapitalismus werde eines Tages durch die Herrschaft der Arbeiterklasse überwunden, führte bei den Liberalen die Geschichte zwangsläufig zu Freiheit und Demokratie. Doch trotz der Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Schulen englischer Geschichtsschreibung soll hier die Whig-Geschichtsschreibung, der bis in die zweite Nachkriegszeit dominierende Ansatz, im Mittelpunkt stehen.
118
Eine der liberalen Vorstellungen war die, die koloniale Ausdehnung des Inselreichs und die Existenz des Empires sei ein wesentlicher und nahezu zwangsläufiger Bestandteil in der britischen Geschichte gewesen. Das Empire respektive das Commonwealth formte als prägendes Element britischen Selbstverständnisses die Herangehensweise an die Kategorien von Nation und Nationalstaat, internationalen Beziehungen und internationaler Zusammenarbeit. Viel weniger als z.B. bei ihren deutschen Kollegen stand bei den englischen liberalen Historikern der Nationalstaat im Mittelpunkt. Nicht nur fand hier das liberale Staatsverständnis seinen Ausdruck, welches den Staat nicht als Selbstzweck sah, sondern als Institution, für die sich Menschen täglich neu entschieden. Es zeigt sich außerdem, dass ein Vielvölkerreich, wie es das Empire darstellte, mit der Idee eines homogenen Staates nicht sonderlich kompatibel war. Die Betonung lag daher weniger auf dem Nationalstaat als auf der Nation, die in dreierlei Hinsicht einen positiven Referenzrahmen bot: Sie war aufgrund des »täglichen Plebiszits« Sinnbild für eine demokratische Gesellschaft, als die sich Großbritannien verstand. Zweitens galt die Existenz eines Nationalgefühls als dienlich für die Ausdehnung von »law and liberty«.[8] Und drittens war die Nation ein ganz selbstverständliches Merkmal nicht nur des europäischen Kontinents, sondern auch des britischen Commonwealth, das meist als ein Zusammenschluss von freien Nationen aufgefasst wurde. Einmütig wurde ein Bild gezeichnet, wonach das Commonwealth glückliche freie Staaten beherberge, die unbehelligt ihre nationale Selbstbestimmung ausleben könnten. Anstelle des durch feste Grenzen fixierten Nationalstaats favorisierten die Historiker die »natural map« oder »natural frontier«, eine Position, die man sich als Inselbewohner einerseits leisten konnte, die aber andererseits der gewünschten Flexibilität der Außengrenzen Großbritanniens und seines Empires Genüge tat. Der Nationalstaatsgedanke hätte hier eine für Großbritannien kontraproduktive Wirkung gehabt.
119
Doch auch wenn man sich eher auf das Volk und auf die Nation und weniger auf ihre Verwirklichung in einem Staat konzentrierte, gab es durchaus Affinitäten zum Nationalstaat. Englische Historiker kritisierten zwar den »Nationalismus«, der, wie das Beispiel Deutschlands zeige, aggressiv sei und nach Gebietsvergrößerungen strebe. Das Erreichen eines Nationalgefühls wurde aber gleichzeitig als Gradmesser zivilisatorischer Entwicklung gebraucht und damit positiv konnotiert. Grundsätzlich gestand man jeder Nation, die den entsprechenden ›Entwicklungsstand‹ erreicht hatte, die Nationalstaatlichkeit zu.[9] Freilich ist zu fragen, inwieweit man bereit war, diesen Schritt bei seinen eigenen Dominions zuzulassen: denn bei weitem nicht, argumentierte Arnold Toynbee, erreichten alle Völker den Status einer Nation, tatsächlich seien die meisten existierenden Völker »undoubtedly unripe« dafür.[10] Die realpolitische Umsetzung der liberalen Grundannahme von der Individualität der Völker hielt man aber deshalb für unproblematisch, weil man davon ausging, dass die Welt eine friedlichere sei, hätten alle Völker – auch die des Commonwealth – einmal ihren Traum vom Nationalstaat erreicht. Dieser Gedanke harmonischen Zusammenlebens spiegelt sich beispielsweise in der Ansicht von George Peabody Gooch, Staaten seien ebenso wie Menschen an moralische Standards gebunden. Erst später, als sich zeigte, dass auch die nationalstaatliche Versorgung nicht zum friedlichen Zusammenleben gereichen würde, erfolgte ein Schwenk von der Betonung des Nationalstaats hin zum Staat per se. 1918/19 aber erreichte der liberale Glaube an den Nationalstaat vorerst seinen Höhepunkt, als die britische Delegation bei den Verhandlungen der Pariser Verträge die Selbstbestimmung zahlreicher kleiner Nationen verfocht und durchzusetzen half. Und davon zeugt auch das Europabild der englischen Historiker. Gerade die Aufteilung in starke selbständige Elemente – Nationen und Staaten – war demzufolge ein typisches Charakteristikum Europas. Die größte politische Errungenschaft bestehe in dem Recht »of freely constituted human groups to work out their own salvation.«[11] Zwar sei eine wirtschaftliche Zusammenarbeit erstrebenswert, politisch aber solle Europa unterteilt werden in »unabhängige, selbstgenügsame, sich selbst entwickelnde Gruppen, in der Lage dazu, in Harmonie Seite an Seite zu leben.«[12] Betont wird also in erster Linie die Unabhängigkeit der Völker und Staaten; an einem breiteren, etwa supranationalen Engagement hatte Großbritannien dagegen wenig Interesse.
120
Die mehr internationalistisch ausgerichtete Strömung des Liberalismus ging davon aus, dass ein Kollektiv übereinstimmende Interessen habe und man sich auf einen Idealzustand sozialer Beziehungen zubewege. In engem Zusammenhang dazu war man zudem der Annahme, ein Zusammenschluss von Nationen werde immer durch geteilte Werte, gemeinsame Interessen und institutionelle Verbindungen zusammengehalten werden.[13] Diese Einstellung reflektierte sich sicherlich in dem Verständnis, mit welchem man dem eigenen Zusammenschluss von Nationen gegenübertrat: ein Klebstoff, mit dem das Commonwealth zusammengehalten wurde, war die Loyalität aller Dominions und Kolonien zur Krone und den britischen Institutionen. Zwar gab es in Großbritannien auch Projektionen supranationaler Verbindungen, die mit dem Commonwealth nicht allzu viel zu tun hatten: grundlegend war das Ideal der Verständigung zwischen den Nationen und das der internationalen Kooperation, ganz unerheblich zunächst in welcher Form. Verständigung und Kooperation schienen den Liberalen vor allem vor und während des Ersten Weltkrieges eine Notwendigkeit zu sein, war doch ein europäischer Krieg erst zur Wahrscheinlichkeit und kurze Zeit später real geworden. Der neu entstandene Völkerbund fand in diesem Rahmen einerseits Zustimmung, erfuhr jedoch auch Ablehnung, da das Commonwealth in seiner Gänze nur schwer in einer weltumspannenden Organisation unterzubringen war. Egal ob pro oder contra Völkerbund: Europa wurde in logischer Konsequenz übergangen. Viele der liberalen Intellektuellen zielten, unter Beibehaltung des Commonwealth, auf einen Zusammenschluss größeren Umfangs. Für die Mitgliedschaft in einem europäischen Staatenverbund war das weltumspannende Vielvölkerreich gänzlich ungeeignet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, zu einem Zeitpunkt, an dem das britische Weltreich einen kritischen Punkt in seiner Existenz erreicht hatte, wurden englische Bestrebungen nach einem supranationalen Verband auf begrenztere – das heißt zum Beispiel: europäische – Maßstäbe geeicht. In den 1920er Jahren hatte das internationalistische Ideal der Liberalen jedoch noch zur Folge gehabt, dass Europa als Modell und Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen wurde. Das Empire genügte durchaus auch sich selbst. Es habe, so die weitverbreitete Meinung, den Internationalismus bereits verwirklicht, versammle in sich alle großen politischen Ideen und gebe Entwicklungsfreiheit bis hin zur Möglichkeit der Selbstregierung.[14] Mithin sei es das Modell für die Rettung der »westlichen Zivilisation«: die Kolonialreiche sollten nicht zugunsten eines »master-states« geführt werden, sondern zum Wohle ihrer »subjects«. »And may we not claim that this has come to be the ruling principle of the British Empire [...] ?« Nur ein Handeln, wie es das Inselreich vormache, sichere die weitere Vorherrschaft Europas.[15]
121
Prinzipiell also scheint der Bedarf an Utopien, wie sie die Ideen eines europäischen oder globalen Zusammenschlusses lange waren, bei den britischen Liberalen eher gering gewesen zu sein. Die Whig-Historiographie schrieb die erfolgsverwöhnte Geschichte des Inselreichs, in der quasi-natürlich alles auf eine parlamentarische Demokratie zulief. Die institutionell-politische und gesellschaftliche Struktur Großbritanniens waren demzufolge der Idealfall menschlicher Entwicklung und die Briten für eine solche Ordnung geboren. Zudem war man geopolitisch saturiert und gleichzeitig kaum angreifbar. Die natürliche Festlegung der Grenzen und das aus der zufriedenstellenden Entwicklung des Landes erwachsene Selbstbewusstsein sorgten für eine gefestigte historische Identität.[16] Diese oder das Wohl des Landes musste daher nicht erst noch gesucht und gefunden werden, erst recht nicht in Europa. Großbritannien konnte sich aus diesem Grund eine gute Portion Eigensinn sehr wohl leisten. Die Fixierung auf den eigenen ›Sonderweg‹ hatte daher einen gewissen Ego- und Ethnozentrismus und Nationalismus zur Folge, der in der englischen Lebenswelt, aber auch in der Geschichtsschreibung die Außerachtlassung anderer Kulturen, und seien sie auch so nah wie die Nachbarn auf dem europäischen Kontinent, mit sich brachte. Erst nach 1945 wurde man sich im Vereinigten Königreich darüber klar, dass man über die Kontinentaleuropäer recht wenig wusste. Die Tendenz, die eigenen Errungenschaften für die besten zu halten, führte zudem zu einem Missionstrieb, der seine deutlichste Ausprägung im Umgang mit den Kolonien erfuhr, aber auch das Bild von ›zivilisierten‹ Staaten und von den internationalen Beziehungen prägte, für die angenommen wurde, mit der Zeit müssten sich Demokratie, Freiheit und Wohlstand in allen Teilen der Welt durchsetzen.
Grundsätzlich war das Empire für die englischen Historiker ein geeignetes Mittel, die nationale Frage und internationalistische Tendenzen miteinander zu vereinbaren. Denn gerade die nationale Selbstbestimmung der Dominions war für Großbritannien ein Alibi, das Commonwealth aufrechtzuerhalten: nach britischer Lesart war die Begleitung der kolonialen Selbstbestimmungsprozesse notwendig und nur im Verbund des Commonwealth möglich. Das Europabild gestaltete sich entsprechend dieser Ambivalenz zwischen Nationalismus und Internationalismus in zwei Punkten: erstens in dem oben beschriebenen skeptischeren Verhältnis gegenüber dem Nationalstaat, teilweise nationalen Tendenzen generell, und zweitens in der Neigung, zwar eine Annäherung der europäischen Staaten vorzuschlagen, letztlich aber den Weltstaat oder eine Weltorganisation vorzuziehen. Denn die Idee eines Universalstaats war eher mit dem Commonwealth zu vereinbaren als europäische Einigungsbemühungen. Für Großbritannien, das sich neben den USA und der Sowjetunion als dritte Weltmacht begriff, wäre ein Heranrücken an Europa in seinen Beziehungen zum Commonwealth eher hinderlich gewesen. Auf diese Weise konnte es sich sogar als Vorreiter supranationaler Organisationsformen und somit als Vorbild für Europa stilisieren. Man kann daher sagen, dass die englischen Historiker aufgrund der britischen kolonialen Erfahrungen einem multinationalen Zusammenschluss offener als mancher ihrer Kollegen vom Kontinent gegenüberstanden – wenn auch fraglich bleibt, ob an einen Zusammenschluss gleichberechtigter Nationen gedacht wurde.
122
Man zeigte also durchaus Interesse am Kontinent, wandte sich aber in letzter Konsequenz wieder von ihm ab. H. G. Wells beispielsweise machte sich durchaus Gedanken über die Zukunft des Kontinents: das Ende der europäischen Zivilisation, so der Autor, stünde bevor, sollten nicht bald der Transport und das Reisen erleichtert und die Grenzen aufgehoben werden. Wenn Europa nicht in Anarchie verfallen wolle, müsse es aufhören, in Kategorien wie »das Volk von England« oder »das Volk von Frankreich« zu denken. Es gehe mindestens um das Volk von Europa, wenn nicht gar um das Volk der Welt[17], warnte Wells. In der Tat war Letzteres sein eigentliches Anliegen; nicht ein vereintes Europa strebte er an, sondern den »world state of all mankind«.[18] »I think I was born cosmopolitan«, sagte Wells, er hielt sich sogar für einen »Anti-Nationalisten«, aber wenn er so über das Britische Empire nachdenke, könne er sich nicht dagegen entscheiden. Das Commonwealth sei nicht zu zerstören, sondern im Gegenteil zu erhalten.[19] Das selbe Muster findet sich auch bei Gooch: ein Interesse an Europa, gepaart mit einer projizierten Einbindung in einen globalen Rahmen. Das Überleben der europäischen Zivilisation hielt Gooch nur für möglich, sollte Europa in den Völkerbund eingegliedert werden.[20] Die Einstellung der englischen Historiker zu Europa war also die einer distanzierten Anteilnahme. Europa sollte in einem »Weltstaat« oder in einer internationalen Organisation wie dem Völkerbund aufgehen und ein Mitglied unter vielen werden. Eine Hinwendung zum Kontinent, ganz zu schweigen von einem Zusammenschluss Europas, war deshalb nicht denkbar, weil es Großbritannien um einen größeren Korpus ging, in welchem Freiheit und nationale Selbstbestimmung herrschten. Englische Historiker, so kann man daher sagen, betrieben Geschichtsschreibung mit einem stark verengten nationalen Blickwinkel und stellten die nationalen Interessen in den Vordergrund. Da diese jedoch hauptsächlich in der Erhaltung des Empires bestanden, zeichnete die britischen Einstellungen ein konsequenter Blick nach außen aus – anders als zum Beispiel die auf den Kontinent ausgerichtete Haltung Deutschlands. Nicht der Nationalismus stand bei den englischen Historikern Europa im Weg, sondern – wenngleich eigennützige – globale Vorstellungen und internationalistische Tendenzen. Für die Frage nach den Voraussetzungen der Europageschichtsschreibung im spezifisch britischen Kontext bedeutet dies, dass es einigen englischen Historikern bereits zu wenig gewesen sein mag, an die Stelle von Nationalgeschichten ›lediglich‹ Europageschichten zu setzen, hatten sie doch bereits die Welt, oder zumindest das Commonwealth, im Blick. Ohnehin hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg mehr und mehr die Auffassung Verbreitung gefunden, Europa sei marginalisiert und die Bedeutung seiner Geschichte relativiert. Europäische Geschichte sei eben nur ein Teil der Weltgeschichte, bemerkte beispielsweise A. J. Grant.[21] Durchgesetzt hatte sich jedenfalls der Eindruck, eine rein auf Nationalgeschichten aufbauende Geschichtswissenschaft sei nicht länger zeitgemäß. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg kritisierte man an deutschen und französischen Europageschichten, dass sie im Prinzip nur Nationalgeschichten seien, die die Ereignisse anderer Länder additiv hinzunähmen.[22] Ein Vorzug der allgemeinen Geschichte sei es doch gerade, die Enge des Nationalismus zu verlassen; stattdessen würde dieser mit der deutschen Variante der Weltgeschichten nur noch intensiviert.[23]
123
Ein europäisches Geschichtsbewusstsein?
124
Legt man als Maßstab jedoch die in der gegenwärtig stattfindenden Diskussion genannten Bedingungen für die Europageschichtsschreibung an, sucht man also nach einer Geschichtsschreibung, die über Westeuropa hinausgeht, den Blick auf Außereuropa wagt, Vergleiche und transnationale Analysen vornimmt, nationale Paradigmen zu überwinden sucht und pluralistisch erzählt, so gilt für die meisten, im Übrigen nicht nur englischen Historiker der ersten Nachkriegszeit lediglich der Tatbestand der Nichterfüllung. Unter diesen Umständen ist jedoch zu fragen, inwiefern die Maßstäbe, die heute gesetzt, aber immer noch von den wenigsten Historikern umgesetzt werden, auf die Geschichtsschreibung vorangegangener Jahrzehnte oder Jahrhunderte angewandt werden können. Schließlich profitiert die Geschichtsschreibung der Gegenwart mit der Präsenz eines institutionalisierten Europas von der Verankerung eines europäischen Bezugsrahmens im Alltag. Kann für vorangegangene Historikergenerationen bereits von einem europäischen Geschichtsbewusstsein gesprochen werden, welches diesen Namen verdient? Was könnte ›europäisches Geschichtsbewusstsein‹ heißen? Was bedeutet ›europäische Geschichte‹? Handelt es sich um Ereignisse, die für ganz Europa bedeutend sind? Wie viele Länder müssen davon betroffen sein, um von einem europäischen Ereignis sprechen zu können? Als problematisch erweist sich dabei, dass in wahrscheinlich keines der historischen Ereignisse und Entwicklungen alle Länder Europas einbezogen waren. Es ist zu fragen, inwieweit die historischen Prozesse, die in Europa stattfanden, nicht doch zu disparat und letztendlich nur regional wirksam waren, um sie als europäisch zu kennzeichnen. Dies hätte zur Folge, die Liste der »wirklich« europäischen Ereignisse recht kurz zu halten. Kann der Dreißigjährige Krieg also als europäisches Ereignis bezeichnet werden, oder war er nicht vielmehr ein transnationales Ereignis auf europäischem Boden? Sieht man den Krieg – oder besser gesagt, seinen Abschluss, den Westfälischen Frieden – als Beginn eines Zeitalters der Säkularisation und der Religionsfreiheit mit europaweiter Ausstrahlung und Implikationen für das europäische Selbstverständnis, so könnte es als europäisches Ereignis und damit als Teil europäischer Geschichte beschrieben werden.
Letztendlich bedeuten diese Überlegungen für die Zukunft, die europäische Geschichte pluralistisch zu denken und zu schreiben. Dies erschwert das Finden einer gemeinsamen europäischen Geschichtslegende, vermag aber die europäischen Peripherien und die unerzählten Geschichten der Europäer mit einzubeziehen und damit die Dominanz der westeuropäischen, nationalstaatlichen, männlichen Geschichte zu überwinden.
125
Nichtsdestotrotz gilt für größere Kollektive, wie Europa eines sein möchte, eine gemeinsame Geschichtserzählung für die gemeinschaftliche Identitätsstiftung als unerlässlich. Vor diesem Hintergrund wird die fehlende europäische Identität, parallel zum Verweis auf die schwach ausgeprägte europäische Öffentlichkeit und – ein Problem speziell des Europas der Europäischen Union – auf mangelnde institutionelle Transparenz und politische Partizipationsmöglichkeiten des europäisches Bürgers, auch auf ein fehlendes europäisches historisches Narrativ zurückgeführt. Bei allen Versuchen, eine Meistererzählung Europas zu schreiben, sollte jedoch die Frage im Raum stehen, inwieweit sich eine Geschichtsschreibung, die historische Ereignisse europäisiert, um sie für ein europäisches Geschichtsbewusstsein gangbar machen zu können, in den Dienst der Erstellung einer solchen Legende stellt. Es könnte gefragt werden, zu welchem Grade dann Versuche der Etablierung eines Narrativs durch Bücher und Museen nicht krampfhafte Installationen einer europäischen Identität sind, eine Entwicklung, die man nach den Lehren aus der Geschichte der Nationalstaaten mit Skepsis betrachten müsste. Vielleicht liegt die Identität und das Selbstverständnis Europas eben nicht in den bisher formulierten Motti, die Europa beispielsweise als Einheit in Vielfalt, als aufgeklärtes und demokratisches Europa oder eben auch als die Verwirklichung eines bestimmten historischen Musters beschreiben. Allzu oft greifen diese zu kurz, weil sie nur einen kleinen Teil der Europäer ansprechen, von zu wenigen sozialen Gruppen oder Ländern geteilt werden oder aber die europäische Geschichte zu optimistisch betrachten und als Orientierungsbaustein daher zu unglaubwürdig sind. Vielleicht liegt der Kern Europas in der Suche nach der rationalen Auslegung eines diffusen Zusammengehörigkeitsgefühls.
126
Gooch, George Peabody: History of Modern Europe. 1878–1919, London 1923.
Grant, Arthur James: A History of Europe, London u.a. 1925.
Grant, Arthur James: Outlines of European History, London 1921.
Holbraad, Carsten: Internationalism and Nationalism in European Political Thought, New York 2003.
Irmschler, Konrad: Großbritannien, in: Gerhard Lozek (Hg.), Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert. Neuzeithistoriographie und Geschichtsdenken im westlichen Europa und in den USA, Berlin 1998, S. 47–112.
Joll, James: National Histories and National Historians. Some German and English Views of the Past, London 1984.
Marquand, David: Nations, Regions and Europe, in: Bernard Crick (Hg.), National Identities. The Constitution of the United Kingdom, Oxford 1991, 25–37.
Martel, Gordon: The Origins of World History. Arnold Toynbee before the First World War, in: Australian Journal of Politics and History 50 (2004) 3, S. 343–356.
Muir, Ramsay: The Expansion of Europe. The Culmination of Modern History, London 1917.
Osterhammel, Jürgen: Epochen der britischen Geschichtsschreibung, in: Wolfgang Küttler / Jörn Rüsen / Ernst Schulin (Hg.), Geschichtsdiskurs. Bd. 1: Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt/M. 1993, S. 157–188.
Soffer, Reba N.: British Conservative Historiography and the Second World War, in: Benedikt Stuchtey / Peter Wende (Hg.), British and German Historiography. 1750–1950. Traditions, Perceptions, Transfers, Oxford 2000, S. 373–399.
Toynbee, Arnold: The new Europe. Some essays in reconstruction, London 1915.
Wells, Herbert George: The Outline of History. Being a Plain History of Life and Mankind, London 5th rev. ed. 1930.
Wells, Herbert George: What Kind is the British Empire Worth to Mankind? Meditations of an Empire Citizen, in: Ders.: The Way the World is Going. Guesses and Forecasts of the Years Ahead, London 1928.
127
ANMERKUNGEN
[*] Susan Rößner, M.A., Mitarbeiterin im SFB 640 »Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel« an der HU Berlin, Teilprojekt A5 »Europarepräsentationen«.
[1] Wells, Outline 1930, Bd. II, S. 2.
[2] Martel, World History 2004, S. 343.
[3] Osterhammel dagegen ist der Ansicht, dass die Historiker in der Zeit der Professionalisierung der englischen Geschichtswissenschaft (ca. 1860/70–1930) diese drei Themen mieden und Nationalgeschichte aufgrund »nationaler Saturiertheit« keine Rolle spielte. Wichtig für diesen Beitrag ist, dass die Prämissen der Whig-Geschichtsschreibung nicht zentrale Themen der englischen Europa- und Weltgeschichtsschreibung, aber als hintergründige Vorannahmen präsent waren und auf diese Weise, so das Postulat, die Art der Europa- und Weltgeschichtsschreibung geprägt haben. Osterhammel, Epochen 1993, S. 174.
[4] Ebd., S. 162.
[5] Jedoch begaben sich viele englische Historiker während des Ersten Weltkriegs in den Staatsdienst, wo sie kriegsrelevante Arbeiten verrichteten, oder forschten gezielt zur außenpolitisch verwertbaren Themen. Siehe u.a. Irmschler, Großbritannien 1998, S. 60.
[6] Verwiesen sei auch auf die Meinung, die Whig-Geschichtsschreibung sei im Wesentlichen ein in Folge des 1950 erschienenen Buchs The Whig Interpretation of History von Herbert Butterfield entstandenes Konstrukt, das die englische Geschichtsschreibung unzulässig reduziere. Tatsächlich aber sind viele der untersuchten englischen Europa- und Weltgeschichten von der Erzählung der britischen innen- und außenpolitischen Besonderheiten bestimmt.
[7] Soffer, Historiography 2000, S. 379.
[8]
[9] Marquand, Nations 1991, S. 28.
[10] Toynbee, Europe 1915, S. 62.
[11] Ebd., S. 18. Hervorhebung durch die Autorin.
[12] Ebd., S. 62.
[13] Holbraad, Internationalism 2003, S. 39.
[14] Muir, Expansion 1917, S. 234.
[15] Ebd., S. 226.
[16] Joll, National Histories 1984, S. 4.
[17] Wells, Outline 1930, Bd. I., S. 63.
[18] Ebd., S. 73.
[19] Wells, Empire 1928, S. 122.
[20] Gooch, Modern Europe 1923, S. 696.
[21] Grant, Outlines 1921, S. VI.
[22] Grant, History 1925, S. V.
[23] Grant, Outlines 1921, S. VIf.
[24] Ebd., S. 2.
[25] Grant, History 1925, S. VI.
ZITIEREMPFEHLUNG
Susan Rößner, Nationale Historiographietraditionen als Voraussetzung der Europageschichtsschreibung. Die Whig-Geschichtsschreibung in englischen Europa- und Weltgeschichten der 1920er Jahre, in: Kerstin Armborst / Wolf-Friedrich Schäufele (Hg.), Der Wert »Europa« und die Geschichte. Auf dem Weg zu einem europäischen Geschichtsbewusstsein, Mainz 2007-11-21 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 2), Abschnitt 117–127.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/02-2007.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008031319>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 118 oder 117–120.